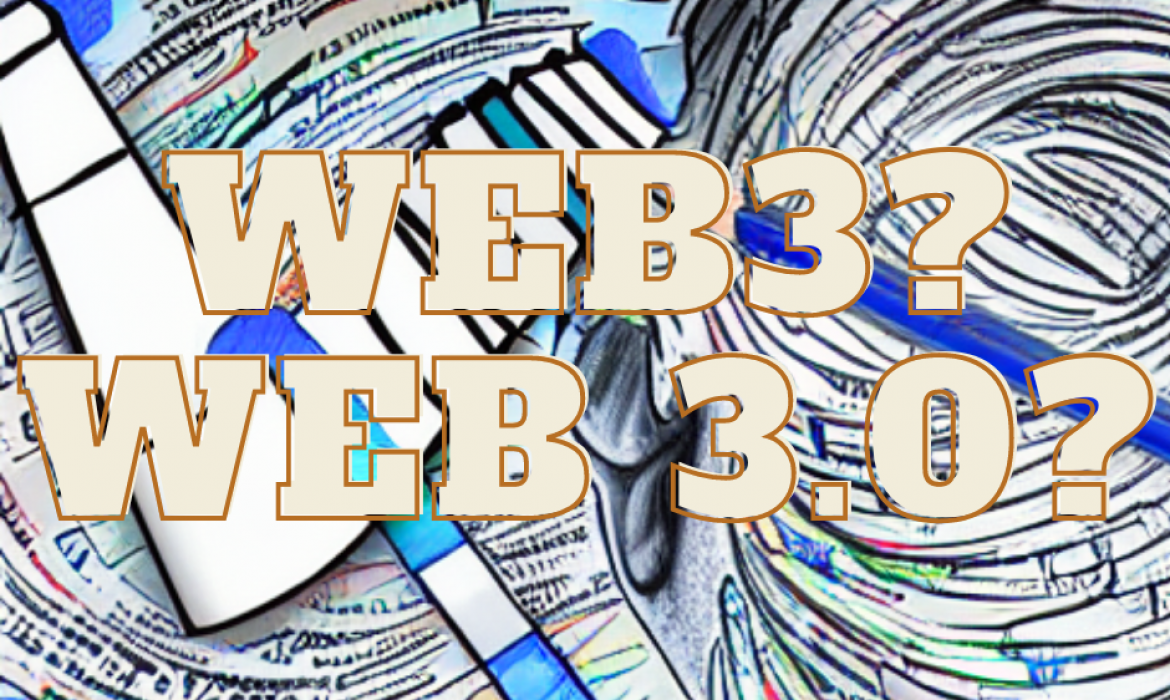Begriffsverwirrung: Das web3 und web 3.0
Das Internet an sich entstand Ende der 1960er-Jahre und hat – bis zu dem, was wir heute sehen und anwenden, zahlreiche technologische und infrastrukturelle Veränderungen durchgemacht. Eigentlich zum direkten Informationsaustausch entwickelt, ist das Internet heute zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Lebens in all seinen Facetten und Bereichen geworden. Das ist sicher vorrangig der Entwicklung des World Wide web und dem HTTP-Protokoll zu verdanken. Danke, Tim Berners-Lee :).
Grob umreißen können wir das World Wide web als Sammlung von Internetseiten bezeichnen, die auf der Vernetzung, dem Internet aufbauen. Die in den webpräsenzen enthaltenen Informationen sind dabei vielfältig, multimedial und von Nutzenden auf aller Welt abrufbar – und verarbeitbar. Während das Internet anfangs statisch war, veränderte sich auch dies durch die Weiterentwicklung und wurde zu dem interaktiven web, welches wir heute wie selbstverständlich empfinden.
Aktuell gibt es immer wieder unterschiedliches Einwerfen von Begriffen – gerade im Kontext Metaverse. Gemeint sind Begriffe wie web3 und web 3.0. Ist das nicht das Gleiche? Nein. Ist es nicht. Beides ist sogar grundverschieden. Vereinfacht ist web3 eine Vision eines auf Blockchain basierendem web, während web 3.0 für eine vernetzte, semantische Variante steht.
Um die Unterschiede klarer zu machen, müssen wir kurz umreißen, was die anderen Varianten – web 1.0 und web 2.0 – bislang waren und wofür diese standen. Denn: die Entwicklung bis dahin war bereits beachtlich.
Inhalt
ToggleDas web 1.0 und 2.0
Die erste Variante, das web 1.0 wird im Grunde durch das World Wide web, 1989 durch Tim Berners-Lee, entwickelt. Das Ende schreiben wir hier etwa ins Jahr 2004. Das, was das web damals ausmachen, waren die statischen Inhalte. Verbindungen basierten hauptsächlich auf Verlinkungen im Hypertext, E-Mails waren textbasiert und Bildanlagen kaum möglich. Die Nutzung war fast ausschließlich passiv – eine Interaktion durch z. B. Feedback oder Bewertungen nicht möglich.
Im web 2.0, auch bekannt als die zweite Generation des webs, ist das, was wir heute mit dem Netz verbinden. Das, was 2004 aufkam und immer noch vorangetrieben und entwickelt wird. Mit diesem Schritt waren und sind wir, als Nutzende, in der Lage interaktiv teilzunehmen oder es zu gestalten. Man kann es auch als “Read-Write-web” bezeichnen und es stellt eine logische Weiterentwicklung der passiven Nutzung des web 1.0 dar.
Es ermöglicht allen Nutzenden des Internets, websites und Inhalte aller Art und aller Medien (user generated content) zu erstellen und verfügbar zu machen. Was die Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität für die Nutzer*innen verbessert und es somit zu dem partizipativen sozialen web macht, das es ist.
Die soziale Konnektivität und Interaktivität des web 2.0 hat zur Entwicklung von Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Co. geführt, auf denen Benutzer Inhalte hochladen können, die andere Benutzer ansehen und ihnen Feedback geben können. Die Ausdehnung und Entwicklung mobile Endgeräte eingeschlossen.
Was ist web 3.0?
Unter dem web 3.0 wird die nächste Generation des webs gesehen. Eine Version, die das vorhandene web um die Ausführung ergänzen soll. Es wird auch als semantisches web bezeichnet und ist eine Erweiterung des World Wide web, die die vom World Wide web Consortium (W3C) festgelegten Standards verwendet. Es zielt darauf ab, das Internet intelligenter zu machen, indem es, mithilfe von Systemen der künstlichen Intelligenz, Informationen mit menschenähnlicher Intelligenz verarbeitet.
Der Begriff “Semantic web” stammt von Tim Berners-Lee, der sich auf eine mögliche Version des webs bezieht, die alles auf der Datenebene miteinander verbinden kann. Vereinfacht könnte man hier sagen, dass Maschinen/Services alle Dinge ausführen und erledigen können, die auf Daten beruhen können. Intelligente Agenten/Assistenzen. Dazu gehört auch, dass derzeitig vorhandene Informationssilos so in der Variante des web 3.0 nicht mehr vorhanden sind.
Was ist web3?
web3 ist ein dezentrales und offenes web. Mit einer derzeitigen Fokussierung auf einer Basis der Blockchain-Technologie. Die Grundidee stammt von Gavin Wood, dem Gründer hinter Ethereum (einer Krypotwährung, basierend auf der Blockchain). Der Leitgedanke: die Schaffung eines dezentralen Internets, ohne die Macht- und Marktdominanz von zentral agierenden web2.0 Silos wie Facebook, Amazon oder Google.
In dem Gedanken des web3 haben Nutzende wieder Datenhoheit und Kontrolle. Das Netz an sich wird, eben durch Nutzung der Blockchain-Technologie, dezentral und gesteuert durch die Gemeinschaft.
Worin liegen die Unterschiede bei web3 und web 3.0?
Das web 3.0 (das semantische web) definiert sich durch die Effizienz und Intelligenz in Bezug auf die Wiederverwendung und Verknüpfung von Daten über websites hinweg. Das web3 (das dezentrale web) hingegen ist geprägt von Sicherheit und Eigenverantwortung, indem es Nutzer*innen die Kontrolle über Daten und Identität zurückgibt.
Im web 3.0 werden alle Daten von Nutzer*innen an einem zentralen Ort gespeichert. Hierüber ist es auch möglich, den Zugriff auf eigene Daten in Bezug auf die Nutzung durch Dritte zu steuern. Diese “Solid Pods” (Solid= Social Linked Data / Pods = Personal Online Data) vergeben eineindeutige webID für Nutzer*innen aus – quasi die digitale Wiedererkennung einzelner Nutzer*innen. Im web3 speichern Nutzende ihre Daten in einer Kryptowährung-Wallet. Der Zugriff wird durch die persönlichen Schlüssel gewährleistet.
Auch in der Nutzung der Technologie unterscheiden sich beide Systeme. web3 setzt auf die Blockchain-Technologie, web 3.0 auf Datenaustausch-Technologien. Durch die zentrale Speicherung der Daten im web 3.0 sind Daten leicht zu ändern, in der web3 ist das allein auf Grund der Blockchain und der damit verbundenen, mehreren Knotenpunkten deutlich schwieriger.
Aber natürlich gibt es auch Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten von web3 und web 3.0
Wie wir oben gelesen und gelernt haben, gibt es Unterschiede zwischen web3 und web 3.0. Sowohl in den Ansätzen und den Konzepten. Aber das gemeinsame Ziel ist gleich: Sie wollen eine bessere Version des Internets zu schaffen, indem die Kontrolle der eigenen Daten von den derzeitigen Informationshaltenden zurück zu den Nutzenden gelegt wird. Aber: Der Ansatz zur Erreichung des Ziels ist, wie beschrieben, anders.
Aus meiner Sicht ist der semantische Weg wahrscheinlicher, logischer (aus heutiger Sicht). Blockchain und Co. verbrauchen endlose Ressourcen, Rechnerleistung und Energie – und mit jedem weiteren Ausbau der Technologie oder Anwendungsbereichen wird dies mehr. Logisch, da hier mit jeder Veränderung, mit jedem verarbeiteten Block, mit jedem Datensatz die Blockchain wächst und damit mehr Speicherbedarf besteht. Aber auch die Verarbeitung an sich (Performance) benötigt Ressourcen – die Transpararenz (z. B. die Offenlegung bereits verarbeiteter Datenänderungen/Transaktionen etc.) steigert den Bedarf zusätzlich. Die benötigte Rechenleistung wäre also enorm und damit auch der Bedarf an Energie.
Auch im Zusammenspiel mit einem möglichen Metaverse erscheint mir persönlich aktuell der Gedanke der semantischen Variante wahrscheinlicher und umsetzbarer. Hier werden sich aber zwangsläufig viele Fragen nach den zentralen Stellen zur Datenverarbeitung und -haltung ergeben. Und ehrlich: keine Ahnung, wie sich das a.) entwickeln wird und b.) was da der richtige Ansatz wird.